Darf es auch grün sein? – Die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage nach MiFID II
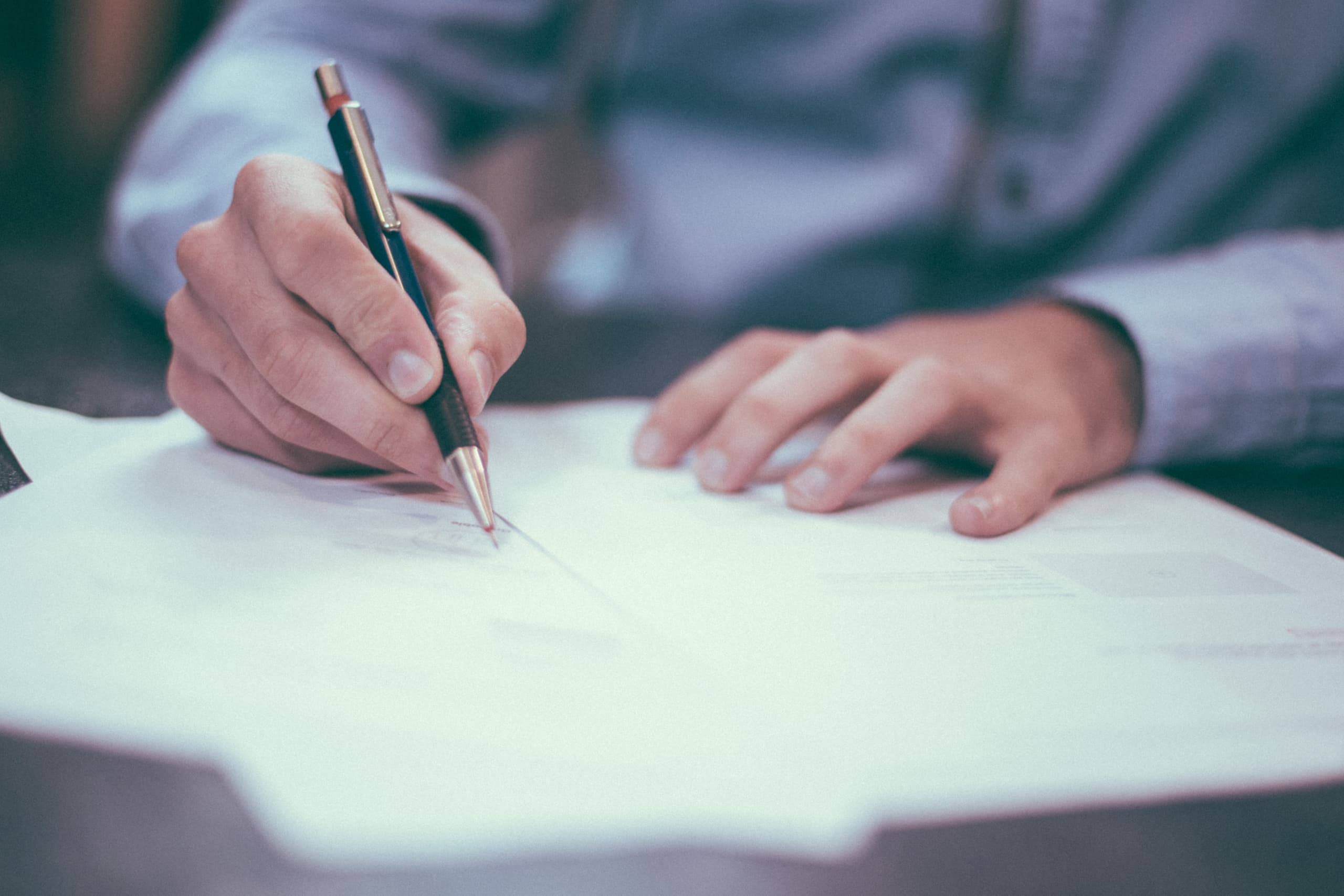
Seit August 2022 müssen Finanz-, Vermögens- und Anlageberater:innen laut der Änderungen der Delegierten Verordnung der Europäischen Union über Märkte für Finanzinstrumente II (EU MiFID II) ihre Kund:innen nach den Nachhaltigkeitspräferenzen fragen und diese in der Anlage berücksichtigen. Diese neue Vorgabe verunsichert viele Betroffene.
Der Fortschritt hin zu einer nachhaltigeren Zukunft ist sehr real und entfaltet sich derzeit überall um uns herum. Laut Statista ist für fast 50% aller Privatanleger:innen in Deutschland wichtig, ihr Geld in Unternehmen zu investieren, die nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen anbieten!
Nach den Datenauswertungen des Deutschen Fondsverbandes BVI kann angenommen werden, dass fast jeder sechste Euro, den deutsche Kund:innen in Fonds investieren, in Produkten mit Nachhaltigkeitsmerkmalen angelegt ist. Es ist klar, dass viele Menschen mit nachhaltigen Finanzprodukten einen Beitrag leisten wollen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Vor ein paar Jahren war das noch nicht vorstellbar, aber die Tendenz ist klar: Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken und gewinnt immer mehr an Bedeutung für jeden Einzelnen, aber auch für Banken und Versicherungen.
Die Kundschaft von morgen
Die neue Einstellung zu einer bewussteren Lebensweise ist spürbar und verbreitet sich sehr schnell, vor allem getrieben durch soziale Medien und anderen digitalen Plattformen. Die Daten- und Informationsflut ist überwältigend und sofort überall verfügbar.
Es lässt sich vermuten, dass zukünftig gut informierte, digital-affine, ethisch motivierte und sehr nachhaltigkeitsbewusste Menschen der mittleren Generation einen immer größeren Anteil der Kund:innen ausmacht. Sie interessieren sich unabhängig vom Preis für Waren und Dienstleistungen, die der Umwelt und den Menschen nicht schaden. Nachhaltigkeit beschäftigt alle, aber in Bezug auf Geldanlagen besonders gebildete, aber auch vermögende Anleger:innen der mittleren bis gehobenen Mittelschicht. Sie erwarten nicht nur eine Rendite unter angemessenem Risiko, sondern auch, mit ihren Investments Sinnvolles zu bewirken.
Aber wie begegnet man diesen Personen? Vor allem sehr gut vorbereitet, dynamisch aber auch empathisch. Besonders das persönliche Beratungsgespräch in den Banken und Versicherungen nimmt entgegen den Erwartungen wieder an Bedeutung zu. Das dirkte Gespräch ist zentral, auch um die maßgeblichen ESG-Bestimmungen der EU verständlich aufzubereiten und die Vielzahl an Investitionsmöglichkeiten zielgerichtet mit den Bedürfnissen der:des modernen Kund:in zu verbinden. Das bedeutet, dass vor allem Berater:in unbedingt auf dem neuesten Stand der Nachhaltigkeitstrends sein sollten und sich gut vorbereiten müssen, um die Kund:innen der Zukunft da abholen zu können, wo sie stehen.
Die Dringlichkeit des Wissenszuwachs ist eindeutig
Das magische Dreieck der Anlageberatung, Rendite – Risiko – Liquidität wird somit nun durch die Dimension der Nachhaltigkeit zu einem Viereck ergänzt. Und das auf allen Ebenen von ESG, also auf der ökologischen und sozialen Ebene sowie unter Aspekten der Unternehmensführung. Diese vier Ebenen gilt es in Einklang zu bringen.
Was bedeutet das also für das Beratungsgespräch?
An erster Stelle steht selbstverständlich eine gute Vorbereitung auf das Beratungsgespräch. Wenn man mit den Konzepten von Nachhaltigkeit bzw. nachhaltigen Geldanlagen sowie allen Regulationen und Verordnungen vertraut ist, wird das Beratungsgespräch für alle angenehmer.
Tatsächlich gibt es auch Beratungs- und Kenntnisstandards für Anlageberater:innen, die von der ESMA, also der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (siehe dazu “Leitlinien der ESMA zu einigen Aspekten der MiFID-II-Anforderungen”), erwartet werden. Diese Bestimmung setzt voraus, dass Anlageberater:innen neben den regulatorischen Anforderungen auch die ethischen Standards verstehen, zu denen sich ihr zugehöriges Institut verpflichtet hat. Ein neuer Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sieht sogar vor, dass das Thema nachhaltige Finanzanlageprodukte zukünftig Gegenstand der Sachkundeprüfung werden soll, darüber muss aber noch endgültig abgestimmt werden.
Die Nachhaltigeitspräferenzabfrage nach MiFID II
Um die Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen umzulenken, wurde der Aktionsplan “Nachhaltige Finanzierung”, auch Sustainable Finance genannt, von der Europäischen Kommission entwickelt. Innerhalb dieses Aktionsplans sind 10 Maßnahmen formuliert. Die vierte Maßnahme lautet “Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Anlageberatung” und mündete in der Ergänzung und Erweiterung der MiFID II Verordnung, also der „Markets in Financial Instruments Directive“.
An dieser Stelle kommen die Berater:innen ins Spiel. Denn seit August 2022 ist es laut MiFID II verpflichtend, bei der nächsten Beratungsleistung die Nachhaltigkeitspräferenzen der bestehenden oder neuen Kunden und Kundinnen abzufragen und in die Anlageberatung mit einzubeziehen.
Die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen gibt den Kund:innen die Möglichkeit, zu bestimmen, ob und wenn ja, welche Aspekte der Nachhaltigkeit ihnen bei der Anlage wichtig sind. Diese Präferenzen müssen dann bei der Empfehlung von passenden Finanzprodukten berücksichtigt werden.
Die Transformation voranbringen
Dieses Vorgehen ist von elementarer Bedeutung für die erfolgreiche Unterstützung der EU-Ziele, auch privates Kapital für die Transformation der Wirtschaft zu mobilisieren. Dafür ist es auch wichtig, das Bewusstsein und die Akzeptanz bei Kund:innen bzw. Investor:innen zu fördern und zu festigen. Damit spielt die Anlageberatung eine wesentliche Rolle bei der Neuausrichtung des Finanzsystems.
Letztendlich ist es wichtig, dass die Grundfrage “Haben Sie Nachhaltigkeitspräferenzen bei Ihrer Geldanlage?” nicht in einer schlichten Ja/Nein-Antwort enden sollte, sondern in eine genaue Bedarfsanalyse der Kund:innenwünsche übergehen soll. Um Berater:innen durch den Dschungel dieser neuen Bestimmung hindurch zu helfen, wurden von verschiedenen Institutionen Hilfswerkzeuge wie erklärende Dokumente oder sogar eigene Programme entwickelt.
Das Forum Nachhaltige Geldanlage hat beispielsweise einen hilfreichen Leitfaden zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach MiFID II erstellt. Dieser Leitfaden stellt eine gute Orientierungshilfe dar. Hier abrufen.
Ablauf
Übergeordnet steht die bekannte Kennenlernphase, in der die üblichen Fragen gestellt werden (Einkommen, Kredite, anderen Geldanlagen, Risikoeinstellung, Anlagebetrag und Anlagedauer), um das passende Finanzinstrument zu finden.
Anschließend reiht sich die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage ein, die sich in 5 Schritte unterteilen lässt:
1. Vorbereitung und Einstiegsfragen
Im ersten Schritt der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage wird die Einstiegsfrage in das Thema gestellt, bei dem die Kund:innenwerte und deren Interesse an Nachhaltigkeit abgeklopft werden.
Dafür sollte das bisherige Vorwissen und Wünsche zu nachhaltigen Geldanlagen des Kunden oder der Kundin erfragt werden. Dabei ist es besonders wichtig, das individuelle Verständnis von Nachhaltigkeit und die persönliche Bedürfnisse des:der Kund:in zu verstehen. Welche Themen sind der Person im Bereich der Nachhaltigkeit besonders wichtig?
Aufschlussreich können neben dem Alter, Beruf und die familiäre Aufstellung auch beispielsweise das Kaufverhalten sein, um einen Einblick zu bekommen, welche Bedeutung Nachhaltigkeit im Leben des Kunden oder der Kundin spielt. Eine Möglichkeit für den Einstieg könnte es auch sein, über aktuelle politische Events wie Weltklimagipfel oder Klimademonstrationen zu reden, aber auch aktuelle Klimakatastrophen können thematisiert werden.
2. Wollen Sie Nachhaltigkeitsaspekte in Ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen?
Nachdem also mehr über das Verständnis von Nachhaltigkeit der:des Kund:in erfahren wurde, folgt der zweite Schritt. Hier richtet sich die Hauptfrage nach den drei folgenden Nachhaltigkeitspräferenzen an die:den Kund:in:
Soll bei der Investition in Finanzprodukte Nachhaltigkeitsaspekte entweder
- gemäß der Taxonomieverordnung und/oder
- der Offenlegungsverordnung berücksichtigt werden und/oder
- auf wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren geachtet werden?

Option 1 wäre, dass so investiert wird, dass es als “ökologisch nachhaltig” gilt. Dabei nehmen wir Finanzprodukte in den Fokus, die einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leisten, wie bspw. Klimaschutz oder Schutz von Wasserressourcen.
Die zweite Option wäre es, in ein Finanzprodukt zu investieren, was neben ökologischen Faktoren auch soziale Ziele und gute Unternehmensführung fördert, wie z.B sozialer Wohnungsbau oder eine diverse bzw. heterogene Zusammensetzung der Mitarbeitenden. Bei den beiden bisher genannten Varianten würde in bereits "positive", also nachhaltige Produkte und Unternehmen investiert werden.
Bei der dritten Option hingegen wird sich darauf fokussiert, besonders Negatives zu vermeiden. Bei dieser Anlagemöglichkeit werden bestimmte negative Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft ausgeschlossen.
Es bietet sich an dieser Stelle an, ein Grundverständnis der Verordnungen an die:den Kund:in weiterzugeben und auf Nachfragen zu reagieren. Die regulatorischen Begrifflichkeiten und Verordnungen wie Taxonomieverordnung und Offenlegungsverordnung werden die meisten Kund:innen nicht gänzlich verstehen, müssen sie aber auch nicht. Es reicht, wenn den Kund:innen die grundsätzlichen Unterschiede und Optionen vermittelt werden. Dafür müssen sich die Berater:innen selbst im Vorfeld ausgiebig über die wichtigsten Regulationen informiert haben. Die Kund:innen können auch in einem Vorgespräch oder beispielsweise per Infobroschüre vorweg darüber aufgeklärt werden, was Nachhaltigkeit, nachhaltige Geldanlagen und die Präferenzabfrage allgemein sind. Übersichten, Schaubilder oder Icons können im Beratungsgespräch eine essentielle Unterstützung sein.
Falls deutlich wurde, dass der:die Kund:in gemäß der Taxonomieverordnung und/oder der Offenlegungsverordnung investieren möchte, sollte noch ein Mindesanteil angeben werden, zu welchem Anteil die nachhaltige Investitionen im Anlageprozess von dem:r Berater:in berücksichtig werden sollen. Es kann zwischen 20, 40, 60, 80 oder gar 100% entschieden werden.
3. Transformation unterstützen
Vor allem, wenn für die Kund:innen ein Portfolio zusammengestellt wird, steht noch die Frage an, ob die:der Kund:in nur in Unternehmen investieren möchte, die schon nachhaltig arbeiten oder auch in solche, die auf dem Wege der Transformation hin zu Nachhaltigkeit sind.
4. Offene Fragen
Nachdem ausdrücklich auf die Wünsche und Ansprüche der:des Kund:in zum Thema Nachhaltigkeit und Investitionen eingegangen wurde, wäre der letzte Schritt – Raum für offene Fragen zu bieten.
Damit beim Beratungsgespräch kein Schritt oder wichtige Fragen vergessen werden, sollte ein Fragebogen zu Hilfe genommen werden. Dieser leitet sowohl Berater:in als auch die:den Kund:in sicher durch die Präferenzabfrage und dient zugleich der Dokumentation des Abfrageergebnisses. Das bietet eine Absicherung – aber auch Haftungssicherheit für die Bank. Verschiedene Anbieter oder Finanzinstitute selber haben solche Dokumente erstellt, aber bislang gibt es noch keine einheitliche oder verbindliche Lösung für alle. Einen Vorschlag für einen allgemeingültigen Fragebogen hat u.a. das Defino Institut für Finanznorm in Kooperation mit Vertretern des DIN-Ausschusses gemacht. Sie finden ihn unter diesem Link: Hier klicken.

5. Die Produktempfehlung
Am Ende des Beratungsgesprächs sollte natürlich eine Produktempfehlung stehen, die an die Wünsche und Bedarfe des Kunden oder der Kundin angepasst ist. Sie können zum Beispiel eine flexible Mischung aus nachhaltigen Fonds zusammenstellen. Dabei sollte die ESG-Anlagelösung mit den ESG-Präferenzen der Kund:innen im Einklang stehen, aber dabei nicht die übergeordneten Anlageziele wie Rendite verletzen.
Falls ein oder sogar kein Finanzprodukt den Präferenzen und Vorstellungen des Anlegenden entspricht, darf auch nichts empfohlen werden. Am besten wird dann erklärt, woran das liegt und was die weiteren Optionen sind. Idealerweise passen der Kunde oder die Kundin die Nachhaltigkeistpräferenzen an, sodass das Produktspekrum sich weitet und andere Produkte empfohlen werden können.
Nicht nachhaltig?
Nicht alle Kund:innen sind von vornherein nachhaltige Geldanlagen gegenüber aufgeschlossen. So existieren nicht-nachhaltige, “ESG-neutrale” und nachhaltige Kund:innen. Personen, die keine Nachhaltigkeitpräferenzen haben, werden als ESG-neutral festgehalten. In diesem Kontext sollte der Beratende den potentiellen Anlegenden noch aufklären, dass ohne ESG-Präferenz das gesamte Anlageuniversum für Investitionen zur Verfügung steht und daher auch nachhaltige Anlagen angeboten werden können.
Unbedingt alles dokumentieren!
Unabhängig davon, ob sich der oder die Kund:in für eine nachhaltige Anlagemöglichkeit entscheidet; eine Dokumentation und Begründung für jeden ihrer Schritte ist zwingend notwendig! Das bedeutet: Es muss in der Geeignetheitserklärung festgehalten werden, ob und welche ESG-Präferenzen geäußert wurden oder ob der:die Kund:in ESG-neutral ist. In den Fragebogen kann z.B. eingetragen werden, ob die Eigenschaften des vorgeschlagenen Finanzinstruments oder die Anlagelösung den ESG-Präferenzen der:des Kund:in entsprechen. Hier müssen gegebenenfalls Abweichungen der Anlagelösungen von den geäußerten Nachhaltigkeitspräferenzen vermerkt werden.
Die Rolle der Berater:innen
Nachhaltig beraten heißt nicht nur über Nachhaltigkeit zu beraten, sondern auch den Beratungsprozess nachhaltig zu gestalten, indem gegenüber den Kund:innen transparent gehandelt und kommuniziert wird, keine falschen Erwartungsversprechen gegeben werden und vor allem ein langfristiger Dialog implementiert wird. Wir befinden uns auf einer langen Reise, wenn es um Nachhaltigkeit geht, in der das Ziel noch nicht erreicht ist und in kurzen Abständen neue Regulationen, Verordnungen aber auch Investitionsmöglichkeiten auftreten.
Das Beratungsgespräch und die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage sind komplexe, zeitintensive, aber sehr wichtige Prozesse zur Umlenkung der Kapitalflüsse in die nachhaltige Richtung, um die Transformationsfinanzierung gemeinsam zu stemmen. Die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage und die MIFID II-Fragebögen sind dabei keine Hindernisse, sondern können ein Instrument zum besseren Verständnis und zur Umlenkung der Kapitalströme in nachhaltige Optionen darstellen. Die Arbeit mit Kund:innen rund um das Thema ESG, der Aufbau von eigenem Fachwissen und die Weitergabe dieses Wissens können sogar langfristig zur Steigerung der individuellen Verkaufsergebnisse führen.


Indem das Interesse der Kleinanleger an nachhaltigen Geldanlagen geweckt wird, unterstützen die Berater:innen die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Denn durch die Beratung und die daraus resultierende ESG-Anlagelösung können die Kund:innen mit ihrem Kapital im besten Fall einen Beitrag zu einer ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und somit einer lebenswerten Welt leisten.

