Greenwashing – Werkzeug für mehr Umsatz?

Diese Form von irreführenden Umweltaussagen zugunsten der Vermarktung eines Produktes wird als Greenwashing bezeichnet.[1]
Auch über ein Jahr nach Einführung der Offenlegungsverordnung bleibt Greenwashing ein wiederkehrendes Problem, das nicht nur Impact Investments, sondern das gesamte nachhaltige Anlageuniversum betrifft. In der Finanzbranche wird unter Greenwashing das bewusst irreführende oder unbegründete Bewerben eines Finanzproduktes als nachhaltig bezeichnet. Ziel ist dabei, Anleger:innen über die wahre Nachhaltigkeitsperformance des Produktes zu täuschen und es als nachhaltiger bewerben, als es tatsächlich ist (vgl. Morningstar).[2]
Definition Greenwashing
Die Europäische Kommission definiert Greenwashing als eine Aktivität, die einem beliebigen Produkt durch irreführende Vermarktung zu einem unfairen Wettbewerbsvorteil verhilft. Greenwashing wird dann als solches bezeichnet, wenn das Produkt gezielt mit Attributen wie „grün“, „ökologisch“, oder „verantwortungsbewusst“ beschrieben wird, um ein nachhaltigeres oder umweltfreundlicheres Bild der Produkts zu generieren. Dies erfolgt trotz nicht erfüllter grundlegender Nachhaltigkeitsstandards. [3]
Ausprägung und Methoden des Greenwashings variieren. So kann Greenwashing durch Falschbehauptungen, aber auch mittels Übertreibung, Beschönigung, irrelevanter Aussagen und absichtlich vager und mehrdeutig gehaltener Beschreibungen betrieben werden (vgl. UL).[4] Angesichts der Absenz einer einheitlichen Begriffsdefinition von Nachhaltigkeit können Vorwürfe des Greenwashings auch von der Kollision verschiedener Verständnisse des Nachhaltigkeitsbegriffs herrühren (vgl. morningstar). [5]
Wieso wird Greenwashing betrieben?
Im Allgemeinen zielt bewusstes Greenwashing auf Verkaufsvorteile. Diese basieren zumeist auf dem öffentlichen Bild, das durch das „grüne“ Produkt erschaffen wird. Unternehmen und Institute müssen auf die Bedrüfnisse ihrer Kund*innen und der Konkurrenz reagieren. Und diese lauten mittlerweile: umweltfreundlich, recyclebar und möglichst plastikfrei. Aus den Bedürfnissen heraus entstanden zwar nachhaltige Produkte, aber auch Greenwashing entwickelte sich. Die Konsument:innen erwerben die Produkt mit einem besseren Gewissen. Die Kaufentscheidung wird demnach positiv beeinflusst, sodass der Kauf mit einem guten Gefühl legitimiert wird. Die Verkaufszahlen können so erheblich gesteigert werden. Außerdem kann der Preis des Produktes höher angesetzt werden. Die Kund*innen sind häufig bereit einen höheren Preis für ein vermeintlich nachhaltiges Produkt zu bezahlen. Hier wird die Entscheidung ebenfalls auf Grundlage des persönlichen Gewissens getroffen und durch Greenwashing beeinflusst. In beiden Fällen werden mehr Gewinne generiert. Aber vorsätzlich und mit Falschaussagen betrieben kann Greenwashing eine Form der irrführenden Werbung darstellen und ist unter Umständen justiziabel (vgl. Osborne Clarke). [6]
Für Kund:innen ist nicht immer im Einzelfall überprüfbar, ob ein Produkt tatsächlich so nachhaltig wie beworben ist, was eine Unterscheidung zwischen echten und vermeintlichen nachhaltigen Geldanlagen erschwert. Infolgedessen besteht das Risiko, dass Negativfälle die Glaubwürdigkeit nachhaltiger Anlagestrategien untergraben werden und sich ökologisch-sozial orientierte Anleger*innen mangels Vertrauens aus dem Markt zurückziehen. Vor diesem Hintergrund warnt Mike Judith, internationaler Vertriebschef bei dem norwegischen Vermögensverwalter DNB Asset Management:
„Greenwashing schadet dem seriösen nachhaltigen Segment.“ (vgl. Tagesspiegel Background) [7]
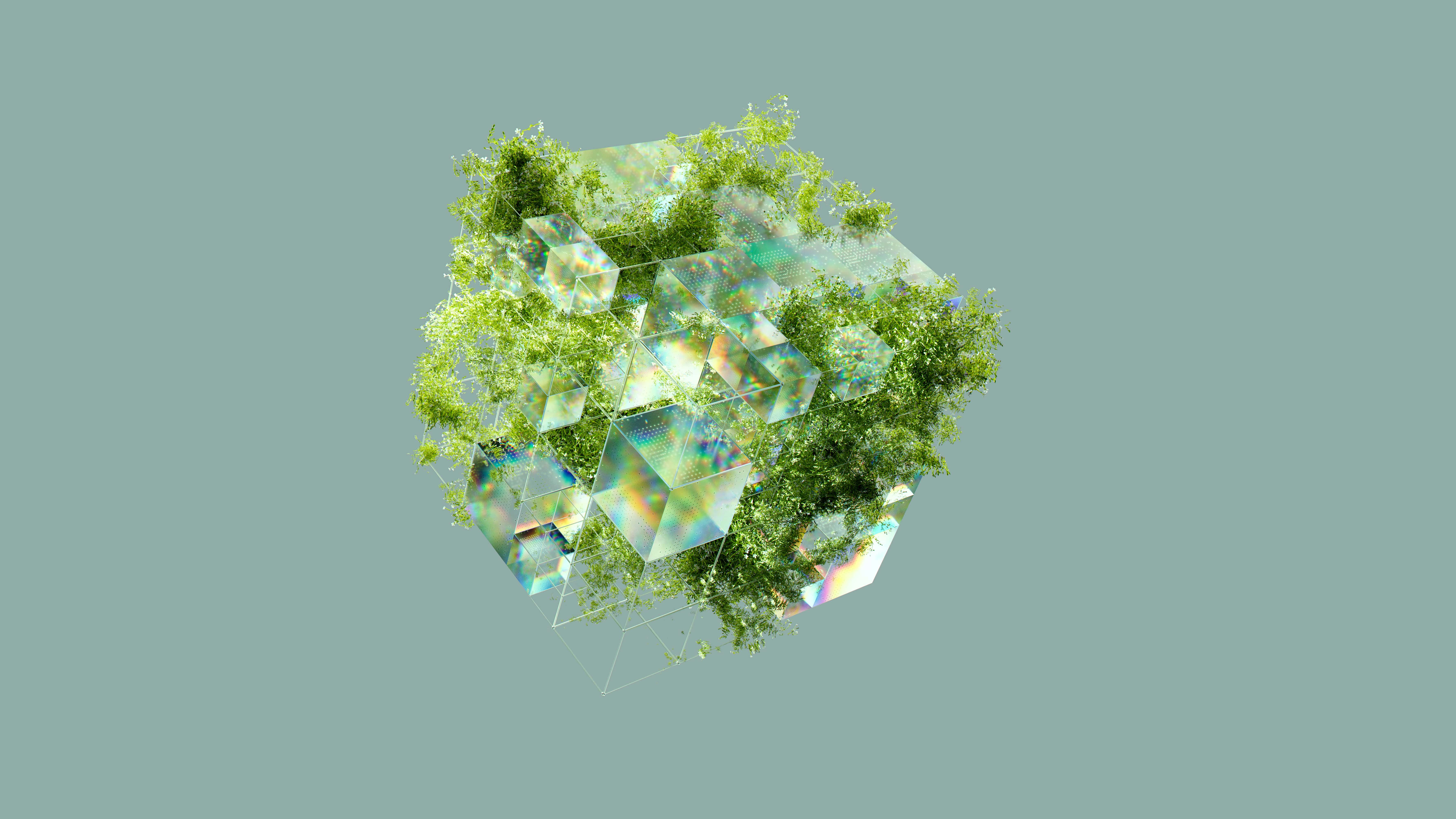
Fazit
Zusammenfassend fällt auf, dass Greenwashing ein gängiges Phänomen in der Vermarktung diverser (Finanz-)Produkte ist. Ob aus Unwissenheit oder als gezieltes Instrument zur Steigerung der Attraktivität eines Produktes. Um sowohl aktives, bewusstes als auch passiv, unbewusstes Greenwashing vorzubeugen, sind konkretere Definitionen und ein klarer Rechtsrahmen, der die korrekte Verwendung von den entsprechenden Attributen festlegt, erforderlich. Zusätzlich dazu bedarf es an flächendeckender Schulung auf Beratungsebene. Wissenslücken können durch Schulungskurse geschlossen werden. Die Gefahr von unbewusstem Greenwashing könnte somit bedeutend minimiert werden. Darüberhinaus wird auch eine neue Ebene mit ethischem Hintergrund tangiert, wodurch ist auch bewusstes, gezieltes Greenwashing minimieren kann.
______________________________________________________________________
[1] https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/green_claims/de.pdf
[3] https://www.emissions-euets.com/carbon-market-glossary/2125-greenwashing
[4] https://www.ul.com/insights/sins-greenwashing
[6] https://www.osborneclarke.com/de/insights/greenwashing-der-werbung
[7] https://background.tagesspiegel.de/sustainable-finance/darum-ist-greenwashing-ein-problem